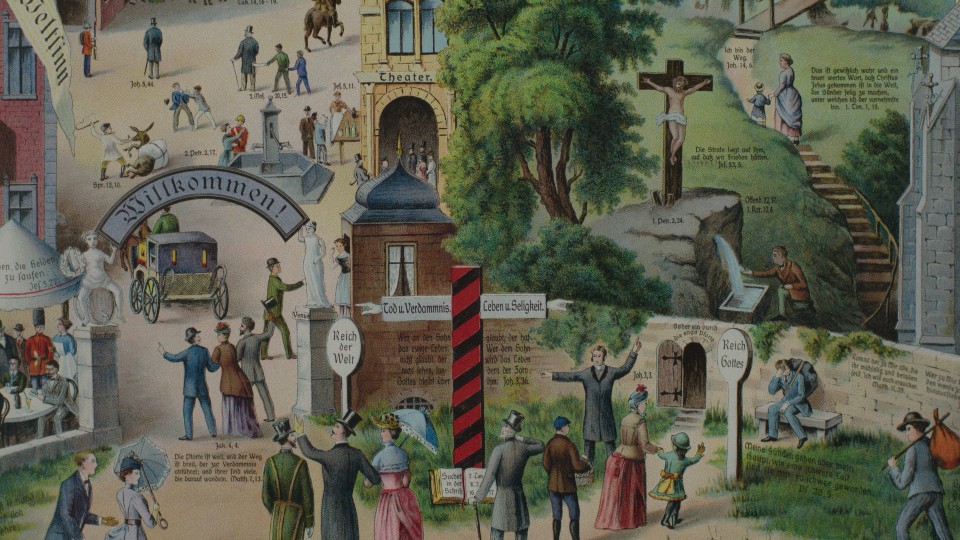Irgendwann musste Rebecca Hirneise weg. Weit weg von ihrer Familie, in der die Religion Kinder wie Erwachsene in ein beklemmendes
Denk- und Lebenskorsett steckt. Der Wunsch nach Verbindung und Verstehen hat sie viele Jahre später in ihren schwäbischen
Heimatort zurückgeführt. In ZWISCHEN UNS GOTT dokumentiert sie ihre Versuche, im eigenen Familienkreis, wo viel gebetet und wenig diskutiert wird, das gegenseitige Befremden
aus dem Weg zu räumen.
Sie verbinden in Ihrem ersten Dokumentarfilm die intime Frage des Glaubens und der Religion mit der der eigenen Familie. Ein
heikles Terrain. Haben Sie lange mit dem Ja oder Nein zum eigenen Filmprojekt gehadert?
REBECCA HIRNEISE: Ja, das habe ich. Eine erste Annäherung hat über eine Gesprächsrunde stattgefunden. Jede:r hat von sich aus erzählt, worum
es gerade in ihrem:seinem Leben ging und wie man leben möchte. In diesen Gesprächen war die Religion bereits sehr präsent,
denn über Religion sprechen meine Verwandten eigentlich oft. Nur diskutiert wird nicht so gern. Das Thema zu wählen und der
Familie mitzuteilen, dass ich über Religion diskutieren will, war alles andere als einfach. Es kam sofort der Einwand, dass
die Diskussionen nur zu Streit führen könnten. Trotz der Skepsis habe ich mich letztlich entschlossen, an meiner Idee festzuhalten
und bin froh, dass wir dann doch alle gemeinsam miteinander gesprochen haben.
Sie beginnen den Film mit Aufnahmen im Flugzeug, offensichtlich der Start zur Reise zurück zu Ihrer Familie. War der bedrückende
Einfluss der Religion der primäre Grund für Ihren Aufbruch gewesen?
REBECCA HIRNEISE: Die Handy-Aufnahme im Flugzeug war meine allererste Aufnahme für dieses Filmprojekt. Ich war ganz aufgeregt und ängstlich.
Ich habe mich versucht zu erinnern, wie es damals war, als ich meine Familie häufiger gesehen habe. Es fühlte sich an wie
eine Reise zurück in eine Welt, die ich bereits vergessen hatte. Ich bin irgendwann aus meiner Heimatstadt weggezogen, um
neue Einflüsse zu bekommen. Meine christliche Familie habe ich aber schon viel früher nicht mehr getroffen. Dabei hat vor
allem die Religion die entscheidende Rolle gespielt. Es gab hin und wieder Familienfeiern, viel mehr aber nicht. So sind wir
uns immer fremder geworden. Ich habe mich vor allem innerlich völlig distanziert und besonders das Missionarische seitens
meiner Großeltern und mancher Onkel und Tanten nicht ausgehalten. Weder als Kind noch als Jugendliche noch als Erwachsene.
Ich habe mich sehr eingeengt gefühlt. Der Film beginnt also mit meinem tatsächlichen Entschluss, wieder in diese Welt einzutauchen.
War es trotz dieser innerlichen wie geografischen Distanznahme überhaupt möglich, zur Prägung durch die Religion auf Distanz
zu gehen? Sitzt dieses Thema nicht viel zu tief?
REBECCA HIRNEISE: Ja, ich denke auch, dass das nicht so einfach möglich ist. In der Zeit, in der ich nicht mehr dort war, hat sich das jedenfalls
sehr rebellisch und unabhängig angefühlt. Ich habe christliche Kreise absolut gemieden und bewusst alte Normen gebrochen –
wenn auch nur heimlich und für mich. Aber beim Zurückkommen habe ich gemerkt, dass es doch mehr Zusammenhänge zwischen meiner
heutigen Persönlichkeit und meinen Wurzeln gibt, als ich zuvor vermutet hatte. Aber auf der anderen Seite distanziere ich
mich noch immer vom Christentum – ein missionarischer Kreis engt mich beispielsweise auch heute noch ein – , aber ich kann
jetzt vielleicht mit einem anderen Selbstbewusstsein sagen, dass ich nicht gläubig bin. Das hätte ich mich früher nicht getraut.
Religion scheint das Thema zu sein, das Ihre Familie verbindet, aber auch trennt. Welche Auslegungen von Religion treffen
in der Familie aufeinander?
REBECCA HIRNEISE: Das ist eine schwierige Frage, der ich nicht zu viel Bedeutung beimessen möchte. Alle in meiner Familie sind evangelisch.
Meine Großeltern sind Methodisten, manche Familienmitglieder gehen sowohl in die methodistische als auch in die normale Landeskirche,
aber es gibt auch verschiedene kleine Freikirchen, die sie immer mal wieder besuchen. Einer meiner Onkel hat nach einem Amerikaaufenthalt sogar seine eigene Freikirche gegründet. Ich glaube, man wird nach dem
Film nicht die verschiedenen Attribute einer bestimmten Konfession zuordnen können, sondern eher sehen, wie die unterschiedlichen
Auslegungen sich auf die zwischenmenschlichen Beziehungen auswirken. Und das gilt meines Erachtens für viele Religionen und
deren jeweilige Konfessionen. Es ist alles andere als eine homogene Glaubenslandschaft. Selbst innerhalb der methodistischen
Kirche gibt es Spaltungen. Allein in „unserer“ Gemeinde gibt es zwei Tendenzen: Eine eher charismatische Richtung, in der
Gläubige andere durch Gottes Hilfe heilen oder in Zungen reden. „Zungenreden“ heißt bei charismatischen Christen, dass Gott
durch einen menschlichen Körper spricht. Die andere Richtung ist eher konservativ, da geht es mehr um die Predigten und um
das richtige „Fromm-Sein“. Und selbst in dieser Unterteilung haben alle einen völlig individuellen Zugang. Als würde man sich
aus der Bibel mit einer Schere herausschneiden können, was einem nicht gefällt. Glaubenstechnisch kenne ich mich nach dem
Film eigentlich weniger aus als zuvor. Permanente Uneinigkeit habe ich von Grund auf mitbekommen. Bereits meine Großeltern
waren sich nicht einig. Er war eher charismatisch, sie eher konservativ. Einer meiner Onkel sagt, je mehr er in permanentem
Kontakt mit Gott ist, desto mehr Wunder geschehen, desto mehr Gutes ereigne sich. Seine Frau sieht das anders. Trotzdem glauben
sie an denselben Gott.
Es entsteht der Eindruck, dass ZWISCHEN UNS GOTT ein Dokumentarfilmprojekt ist, wo sehr wenig vorhersehbar war. Wie haben
Sie eine Struktur gefunden?
REBECCA HIRNEISE: Es war tatsächlich alles schwer planbar. Wir hatten viele Protagonist:innen für einen Film in dieser Länge, wollten aber
alle intensiv kennenlernen und möglichst präzise deren Konflikte mit der Religion herausarbeiten. Mit dem Co-Autor Philipp
Diettrich und dem Kameramann Tilmann Rödiger habe ich sehr intensive und lange Gespräche geführt, um den Film zu strukturieren.
Eine große Frage war, wie man die jeweiligen persönlichen Hauptthemen meiner Onkel und Tanten bei den Dreharbeiten bestmöglich
herausarbeiten kann. Zu Beginn habe ich mich viel an den Gesprächsrunden orientiert. Dadurch haben wir uns intensiver kennengelernt
und auch das Team ist immer mehr mit der Familie zusammengewachsen. Immer wenn wir für Gesprächsrunden gekommen sind, haben
wir versucht, so viel wie möglich vom Alltag meiner Verwandten zu filmen. Eine Struktur mussten wir mehrmals finden. Beim
Schreiben, beim Drehen und beim Schneiden. Gerade im Schnittraum mit Florian Kecht ist sehr Vieles nochmal neu entstanden.
Wie haben Sie Ihre Settings außerhalb der Gesprächsrunden gefunden, wo auch tolle symbolische Orte dabei sind, wie der Swimming-
Pool, der als Taufbecken fungiert. Hat sich Vieles ergeben?
REBECCA HIRNEISE: Wir haben uns viele Gedanken um die jeweiligen Drehsituationen gemacht. Bei der Heilungskonferenz war der Pool das Hauptgesprächsthema,
wenn es um Taufe ging. Es sind bereits viele Leute in diesem Pool getauft worden. Ein Heiler, der regelmäßig ins Haus meines Onkels kommt, um die christlichen Heilungskonferenzen zu veranstalten, wollte mich unbedingt
taufen, da die Kindertaufe in manchen Kreisen nicht zählt. Während der dreitägigen Konferenz hat er mich immer wieder zur
Taufe gedrängt und permanent in der Gruppe gesagt: „Rebecca lässt sich heute taufen.“ Das war von meiner Seite nicht gewollt,
ich hatte nie danach gefragt. Aber er ließ nicht locker. Fast alle, die dort waren, hatten ein richtiges Bedürfnis, sogar
einen richtigen Drang, mich zur Taufe zu überreden. Das war eine seltsame Zeit. Nur meine Tante wollte sich auch nicht taufen
lassen – da haben wir uns sehr verbunden gefühlt. So bekam der Pool auch für mich persönlich immer mehr Bedeutung und ich
wollte unbedingt in diesen Pool schwimmen gehen. Mit meiner Tante – aber ohne Taufe!
In einer sehr eindringlichen Szene spricht einer Ihrer Tanten darüber, wie sehr sie die religiöse Strenge der Eltern eingeengt
hat und sie versucht dabei, aus dem Kader zu weichen. Wie haben Sie mit Tilman Rödiger die Kameraführung besprochen und auch
Ihren Platz im Bild und im Off, als Regisseurin und Protagonistin zugleich gefunden?
REBECCA HIRNEISE: Gerade bei dieser Szene kann ich das gar nicht so gut beantworten, denn es gab im Arbeitsprozess eine Zeit, in der ich das
Bedürfnis hatte, manche Szenen selbst zu filmen. Das ist eine davon. Es war eine sehr kleine Kamera, die schnell zu bedienen
ist. Daher sehen die Szenen auch etwas anders aus. Es war uns ganz wichtig, bei diesen Szenen unseren Protagonist:innen emotional
und daher auch ihrem Gesicht möglichst nahe zu kommen, deswegen waren wir mit einer sehr kleinen Kamera nur zu zweit präsent.
Meine Tante geht weinend aus dem Bildausschnitt heraus – ihr mit der Kamera zu folgen, hätte ich als aufdringlich empfunden.
Bei einem anderen Gespräch war ich sogar so sehr emotional involviert, dass ich kurzzeitig gar nicht mehr in die Kamera geschaut habe. Das heißt, das
Abdriften und Wackeln ist auch irgendwie ein Zeichen meiner eigenen Instabilität und Emotion in diesen Momenten. Da merkt
man am ehesten, wie befangen ich war von dem, was da passiert. Wichtig war für mich, dass Tilmann immer dabei war. Ohne ihn
wollte ich nicht drehen. Durch ihn war es möglich, meinen Spagat zwischen Filmemacherin und Familienmitglied am Set zu meistern.
Wir wussten vor Ort eigentlich beide genau, was wir filmen wollten. Dann ist es aber meist anders gekommen, wir mussten alle
unsere Pläne auf den Haufen werfen und improvisieren. Da hat aber die Vorbereitung dennoch sehr gut getan. Meine eigene Positionierung
in Bild und an der Kamera war bis zuletzt eine permanente, sich wandelnde Frage. Ich wollte mich eigentlich nicht filmen lassen,
sondern immer nur die anderen sehen. Aber durch meine Doppel- bzw. Dreifachrolle gab es irgendwann keine Trennung mehr. So
kam es, dass ich immer mehr im Bild bin.
Ihr Blick auf den Ort, wo sie gedreht haben, hat etwas von einer sehr aufgeräumten Kleinstadt. Welche Gedanken gab es dazu?
REBECCA HIRNEISE: Wir haben in meinem Heimatort Mühlacker gedreht. Das Wahrzeichen von Mühlacker ist ein Sendemast. Daher war der Arbeitstitel
des Films auch Funkstille, weil dieser Funkturm fürs „Senden“ steht. In meiner Familie ist immer sehr viel Missionarisches gesendet worden, richtig
geredet wurde aber nie. Mein Großvater ist auch direkt im Sendegelände aufgewachsen und hat dort (wie auch sein Vater) gewohnt
und gearbeitet. Daher hatte der Sender anfangs eine symbolische Bedeutung und war auch ein familiärer Ort. Das ist im Laufe
der Arbeit weggefallen, weil es immer mehr um die zwischenmenschlichen Beziehungen ging. Der Ort selbst liegt in Schwaben.
Bei den Schwaben ist immer alles sortiert und sauber. Eines der großen schwäbischen Lebensziele ist es, ein Haus zu bauen
und einen schönen Garten zu haben. Es schien mir interessant, den Blick von oben auf die vielen Häuser zu haben, weil ich
beim Betrachten der Häuser über die zwischenmenschlichen Beziehungen der dort lebenden Menschen nachdenke. Es hat etwas von
einer Modellbaustadt, auf die man draufschaut. Und es war mir wichtig, dass das Bild auch auf andere Kleinstädte übertragbar
ist.
Gab es Dinge, die Sie gerne gedreht hätten, was aber nicht möglich war?
REBECCA HIRNEISE: Ich hätte gerne viel mehr von den verschiedenen Gottesdiensten oder christlichen Freizeitaktivitäten gefilmt, an denen meine
Onkel und Tanten regelmäßig teilnehmen. Es war mein großer Wunsch, mit der Kamera die christliche Selbsthilfegruppe (die mein
Onkel leitet) zu beobachten oder beim Heilungsgottesdienst sowie diversen Andachten mitzufilmen. Wir haben manches auch gefilmt,
es wären aber letztlich zu viele verschiedene Elemente gewesen, die nicht in gleichen Maßen im Film verteilt gewesen wären.
Jetzt gehen wir von Person zu Person und bei jeder kommt ein Aspekt des Themas dazu. Noch mehr Input hätte das Format gesprengt.
Warum war es wichtig, dass das Nicht-Zeigbare, das hinter geschlossenen Türen stattfindet, dennoch im Film seinen Platz hat?
REBECCA HIRNEISE: Es war mir wichtig, dass man zumindest einen Eindruck von Dingen bekommt, die nicht so selbstverständlich sind. Eine Andacht
kennt man vielleicht, aber ein Heilungsgottesdienst oder eine Heilungskonferenz ist doch etwas, von dem man nicht unbedingt
weiß, wie es abläuft. Um meine Onkel und Tanten zu verstehen, ist das aber essentiell. Wir haben z. B. mit meinen Tanten auch
ein Frauenfrühstück besucht, was zu ihrem gläubigen Alltag gehört. Die Bilder davon hätten aber wieder neue Personen in den
Film eingeführt, was die Orientierung noch schwieriger gemacht hätte. Wir hatten es lange drinnen, letztendlich ist uns klar
geworden, dass wir innerhalb der Familie bleiben müssen. Es war eine schwere Entscheidung, diese Szenen herauszunehmen, aber
es hat den Film fokussierter gemacht.
Ein interessanter Aspekt ist das Foto- und Filmarchiv Ihres Großvaters, das auf einer Recherche-Ebene, aber auch auf einer
bildsprachlichen Ebene einen interessanten Input geliefert hat. Was haben diese Bilder in den Film eingebracht?
REBECCA HIRNEISE: Ich kannte das Archiv meines Großvaters seit meiner Kindheit. Immer mal wieder wurde einer der Filme gezeigt. Einige Bilder
davon hatte ich noch in Erinnerung. Für den Film habe ich eigenmächtig das Archiv durchforstet. Ein Aspekt, der mich sehr
verwundert hat, war der, dass mein Großvater seinen Kindern verboten hat, ins Kino zu gehen, gleichzeitig aber selber Filme
gemacht hat. Er hat seine eigenen Filme zu Hause sehr sorgsam geschnitten und hatte Verständnis und Liebe für das Medium.
Dennoch seinen Kindern, aber auch sich selbst das Kino zu verwehren, das war mir irgendwie suspekt. Und als Filmemacherin
finde ich das natürlich auch sehr traurig, wenn ich daran denke, was er alles verpasst hat.
Ich war ein einziges Mal mit meinem Großvater im Kino, er selbst war zu dem Zeitpunkt schon dement und wollte sich mit mir
einen Film über Demenz anschauen. Da hatte er schon viel von der Religion vergessen. Durch das Kinoverbot war sein Filmarchiv
für mich noch wichtiger, er hat sehr schöne Aufnahmen gemacht. Das christliche Jugendcamp zu sehen, aus der Zeit als meine
Onkel und Tanten noch Kinder waren, hat mich sehr berührt, weil mich etwas auch an meine Kindheit erinnert hat.
Wie sehr ging es Ihnen darum, Ihre Verwandten in ihrer Religiosität zu verstehen?
Wie sehr ging es Ihnen darum, Ihrer Familie verständlich zu machen, dass Sie nicht glauben?
REBECCA HIRNEISE: Da gibt es mehrere Phasen. Zuerst ging es darum, der Frage nachzugehen, wer meine Verwandten sind und woran sie glauben.
Und dann gab es eine Zeit, in der ich mich nochmals neu distanzieren musste. Ich war auch verärgert, wie teilweise miteinander
gesprochen wurde. Dann kam die Phase, wo ich so viel wie möglich wissen wollte, wie das genau funktioniert. Es war auch interessant
zu sehen, wie sie sich ihren Glauben jeweils zurechtlegen, wie sie sich selber positionieren. Da ich gesehen habe, dass die
Religionsauslegung bei allen so unterschiedlich ist, war dann schon fast egal, wie ich dazu stand. Zum Ende ging es meinerseits
nur noch um ein Forschen.
Es gibt dennoch auch Momente, wo Sie sich auf Diskussionen über den Glauben einlassen. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet?
REBECCA HIRNEISE: Für diese Gespräche habe ich im Vorhinein versucht, möglichst viele Argumente zu sammeln, um meine Position darzulegen. Es
hat mich geärgert, dass, wenn ich meinen Standpunkt des Nicht-gläubig-Seins erklärt habe, dies teilweise einfach vom Tisch
gewischt wurde. Viele der Statements und Argumente sind so diffus und persönlich, da kann man auch nicht mehr dagegen argumentieren.
Mit der Zeit habe ich das weniger an mich herangelassen oder es zumindest versucht. Man muss bei so einem Projekt irgendwann
darauf verzichten, sich ständig positionieren zu wollen. Sonst erfährt man ja nichts. Bis dahin habe ich immer wieder versucht
zu argumentieren, dass es doch so viele verschiedene Wahrheiten gebe, und gefragt, wie es denn möglich sei, nur eine einzige
als richtig zu erachten.
Wie sieht Ihre persönliche Bilanz aus? Haben Sie Fragen, die Sie seit langem mit sich getragen haben, beantworten können?
REBECCA HIRNEISE: Ich habe durch die Arbeit an diesem Film ein größeres Verständnis für Spiritualität bekommen. Ich bin durch den ganzen Prozess
vielleicht stärker geworden, wenn ich beispielsweise das Gefühl habe, dass Grenzen überschritten werden. Ich sitze nicht mehr
mit meiner Familie bei Tisch, ohne mich zu äußern. Früher habe ich einfach nichts gesagt. Es ist für Außenstehende vielleicht
nur schwer nachvollziehbar, welch riesiger Schritt es für mich war, meiner Familie zu sagen, dass ich nicht gläubig bin. Aber
das ist so einprogrammiert gewesen. Jetzt ist es so, dass ich offen kommunizieren möchte, dass ich nicht glaube und ich mich
sogar freue, wenn es zu Diskussionen kommt. Dass das möglich ist, hat gewiss mit der Arbeit für dieses Filmprojekt zu tun.
Dennoch bin ich etwas ratlos, weil meine Arbeit nicht wirklich Grundlegendes verändert hat. Ich bin weniger gläubig als zuvor
und wer vorher missioniert hat, missioniert weiterhin. Wir verstehen untereinander die verschiedenen Positionen jetzt besser,
das hat mir zumindest meine Tante bestätigt. Gespräche gab es vor dem Film einfach nicht. Das ist eine schöne Bilanz, trotzdem
ist dieses Thema weiterhin sehr aufgeladen und führt schnell zu Streit. Wenn ich daran denke, dass manche Familienmitglieder
nicht über ihren Glauben reden, obwohl er tagtäglich omnipräsent ist, macht es mich traurig. Ich bin immer für die Kommunikation
und das Verstehen. Dass man in einer Ehe nicht mehr über das eigene Lebensthema redet, ist für mich absolut unvorstellbar.
Haben Sie sich in dieser Begegnung mit der Familie „drinnen“ oder „draußen“ gefühlt?
REBECCA HIRNEISE: Schwierig. Ich würde sagen, das hat ganz viel gewechselt. Am Anfang habe ich mich natürlich sehr viel „draußen“ gefühlt,
habe empfunden, dass ich zu null Prozent da hineinpasse. Meine Verwandten kennen mein Leben in Wien nicht und es unterscheidet
sich sehr von ihrem. Ich ging zurück nach Hause, zog mir unbewusst ein Gewand an und habe begonnen alle kennenzulernen. Dort
war nicht meine Realität, insofern war ich permanent „außen“. Zumindest habe ich das so wahrgenommen. Ich habe dann aber gemerkt,
dass es Ebenen gibt, die mir zeigen, dass ich zur Familie gehöre. Es gibt Momente, die bewusst machen, dass trotz allem ein
Band bestehen bleibt. Persönliche, aber auch ganz andere, abstraktere. Nach so vielen Jahren erinnerte ich mich an Gerüche,
an Räume, an ganz viel Sinnliches, dass mir dennoch ein Gefühl von „innen“ vermittelte. Das war zeitweise sehr verwirrend,
so nebeneinander „innen“ und „außen“ zu sein.
Wie sehr ist Ihre filmische Arbeit, auch ein Versuch trotz völlig divergierender Haltungen zu einem Miteinander zu finden?
Wie sehr lässt der konzentrierte Blick auf die Familie auf eine breitere gesellschaftliche Ebene schließen, in einer Zeit,
wo Menschen vermehrt in Blasen leben und sich in kleinen Gemeinschaften manchmal irrationale Wahrheiten zurechtrücken?
REBECCA HIRNEISE: Das war jedenfalls mein Ziel, ein Miteinander zu finden. Ich plädiere für das Gespräch. Es bringt einen immer weiter, wenn
auch nicht unbedingt in dieselbe Richtung. Ich hoffe, dass der Film sich auf verschiedene gesellschaftliche Themen übertragen
lässt. Für mich ist das permanent sichtbar und möglich. Deshalb habe ich auch so wenig wie möglich im Film offengelegt, um
welche Religion es sich handelt. Das Muster Glaube und Religion ist meines Erachtens völlig übertragbar auf andere Religionen.
Die Menschen, mit denen ich spreche, könnten auch jüdisch oder muslimisch sein. Dass man bei diesem Film andocken kann, egal
aus welcher Religion man kommt, wäre mein Ziel.
Interview: Karin Schiefer
Jänner 2024